Über den inneren Druck bei musikalischen Aufführungen
und deren Vorbereitungen
Persönliche Betrachtungen und Zeichnungen von Ingolf Turban
„Eigentlich habe ich mich sehr gut vorbereitet und auf das Konzert gefreut. Dann kam ich auf das Podium, es war ein schöner, mutiger und klangvoller Start – bis ich plötzlich irgendwie den Faden verlor und meine Nerven auch. Meine eiskalten Finger haben sich in irgendwelche Passagen verirrt, ich wurde immer schneller und schneller, fand keinen Halt mehr, verlor auch meinen stabilen Stand, so als würden sich die Bretter, die mir eine ganze Welt bedeuten, plötzlich neigen… je mehr ich mich kontrollieren wollte, desto schlimmer saugte mich eine bisher unvorstellbare Energie aus der Musik heraus, die ich doch so liebe.
Was mache ich nur falsch…?“
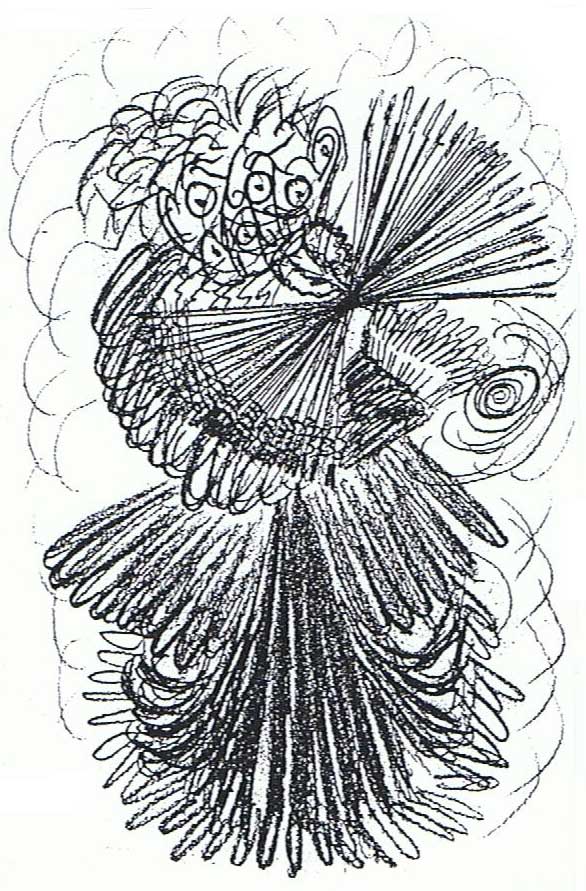
Nicht selten höre ich solche Sätze während meiner Arbeit mit den unterschiedlichsten Studierenden, gerade auch auf Meisterkursen, wenn man sich eigentlich noch kaum kennt und dennoch das Geschenk enormen Vertrauens genießt. Evident ist der Leidensdruck, aber auch der Unterton der Selbstanklage während solcher offenen Gespräche. Bei näherer Betrachtung fällt mir dabei fast gleichlautend Folgendes auf: Beklagt wird vor allem der als solcher empfundene Kontrollverlust. Interessant, dass die Studierenden meist von selbst auf diesen kardinalen Punkt kommen! Es ist lediglich die Frage, mit welchem Blickwinkel diese Thematik angesteuert wird. Ich wage zu behaupten, dass sich hinter dem Schlagwort „Kontroll- verlust“ eher das Gegenteil verbirgt: Es ist allzu oft ein „Zuviel“ der Kontrolle antrainiert worden, und diese vermeintliche, gut gemeinte „Selbstbeherrschung“ beherrscht in Stresssituationen dann eher uns als wir sie. Konkret kann das bereits im Unterricht bedeuten: würde ich Studierende scharfzüngig zurechtweisen, dass etwa diese oder jene Stelle „mal wieder nicht sauber intoniert worden ist“, würde ich in meinem Gegenüber ein Problembewusstsein etablieren, das sich je nach Charakterzug zunächst in schlechte Laune, Selbstbezichtigung, nicht ausbalancierte Körperhaltung bis hin zu physischem Druck übersetzt. Gelingt „dennoch“ eine Verbesserung der Intonation, so ist sie eher dem kurzfristigen Erfolg einer militärischen Durchhalteübung gleichzusetzen. Doch das Opfer ist hoch: der saubere Ton wird „erkämpft“, die innere Verkrampfung bereits zuhause eingeübt. Das Dilemma nun ist, dass sich diese Arbeitsweise als „unabdingbar“ maskiert: als fehlgeleiteter „Fleiß“, der aus endlosen Wiederholungen immer derselben „Problemstellen“ besteht, ohne den angeblich kein Erfolg zu erringen wäre. Typisch hierfür ist ein geradezu rituelles Verhaltensmuster: Man nimmt erst einmal einen schwungvollen Anlauf im nicht reduzierten Tempo, erreicht die „Problemstelle“, scheitert an ihr und ärgert sich. Der Vorgang wird abgebrochen. Unser „Problemstammbaum“ hat sich schon jetzt bereits verzweigt: erstens haben wir unser Versprechen uns selbst gegenüber, das Stück mal wirklich durchzuspielen, gebrochen. Zweitens haben wir im vollen Tempo uns selbst gegenüber den Beweis erbracht, dass wir diese und jene Stelle nicht „beherrschen“. Drittens schwören wir uns, beim nächsten Anlauf wirklich alle geballten Kräfte einzusetzen, um dennoch über die Hürden zu kommen. Kommt physischer Kraftaufwand ins Spiel, folgt viertens Verkrampfung quasi auf dem Fuße. Sollte dennoch kurzfristiger Erfolg zu verzeichnen sein, haben wir fünftens einen blendenden Selbstbetrug geleistet und sechstens unser „Arbeitsgewissen“ oberflächlich beruhigt…
Wie sollte man denn unter solchen Voraussetzungen den „Halt“ erstmals auf dem Podium erwarten und eine Konzentration herbeiwünschen, die man sich selbst zuvor „dank“ permanenten und willkürlichen Unterbrechens unsäglich zerschnitten hat? Wenn wir uns stark vereinfachend unser Hirn als Datenspeicher vorstellen, der hungrig sei auf das, was wir ihm einspeisen, sollten wir sehr genau darauf achten, welche „Speise“ wir ihm vorsetzen sollten und welche lieber nicht. Sind die „Brocken“ zunächst zu groß, werden wir sie eben „zerkleinern“, bis wir sie aufnehmen können. Und wie es auch beim Essen gilt: wer langsam isst, genießt und verdaut besser! Und beobachtet genauer, was gegessen, vielleicht sogar, wie gegessen wurde!

An dieser Stelle möchte ich einem drohenden Missverständnis vorbeugend begegnen: das voran stehende Beispiel aus herkömmlichem Unterricht zum Thema Intonation soll nicht Lehrende zurechtweisen, sondern anhand eines von tausenden Details aufzeigen, wie enorm sensibel der Grat ist, auf dem wir uns hier bewegen. Selbstverständlich wird eine präzise Untersuchung etwa der Intonation immer einen ganz wesentlichen Raum einnehmen bei Streichern, Bläsern und Sängern. Dabei ist das „Wie“ entscheidend: Gelingt es, quasi „mit gemeinsamem Ohr“ zu hören, gemeinsam zu hinterfragen, wie dieses oder jenes wirkt, das man tut, in den Raum projiziert, welche Übemethode typologisch angepasst diesen
oder jenen Effekt hat, dann gelingt auch, ohne es explizit zu formulieren, ein wachsendes Vertrauensverhältnis: nicht nur zu den Lehrenden, sondern – vor allem! – zur eigenen Tätigkeit. Dann werden Fehler nicht zu „Feinden“, sondern zu spannenden Herausforderungen, die es entspannt anzunehmen gilt. In diesem mentalen Stadium kann sich zudem eine Art „alter ego“ aufbauen, mit dessen distanzierter Optik der eigene Beobachtungs- status entscheidend gestärkt wird. Eine fast amüsierte Attitüde kann die wunderbare Folge werden, die einer ernsthaften Arbeit die unnötige Strenge nimmt und sie uns spiegeln hilft. Es ist das selbst-
reflektierende Arbeiten, das den „inneren Pädagogen“ in uns wachruft,
es ist das gelegentliche Innehalten, die völlige Stille zwischendurch, die uns ermöglicht, in uns zu gehen, um höchst individuelle Lösungs- wege zu erspüren. Und hier setzt dann auch der „öffentliche Test“ an: Kann ich mir das, was ich in Ruhe zuhause zugelassen habe, auch auf dem Podium ermöglichen? Wie genau erlebe ich das Podium, was macht meine Atmung beim Auftreten, wie spüre ich meine Füße, kann ich Stille vor den versammelten Menschen lediglich „aushalten“ oder begrüße ich sie sogar als geradezu gemeinsame Konzentration, noch bevor der erste Ton klingt? Erlebe ich meine Aufregung noch immer als panisch eingefärbtes Moment, gegen das ich bisher glaubte, ankämpfen zu müssen, oder ist sie nicht viel eher Transportmittel meiner momentan gesteigerten Energie, die ich nun endlich loswerden, ja: verschenken darf? Am liebsten würde ich das vorbereitende „Üben“ vergleichen mit dem Vorgang, in Ruhe und Genauigkeit meinen Koffer für eine lange Reise zu packen. Alle Utensilien werden sorgsam bedacht und assoziieren eine sichere Zukunft. Im Unterschied zur Reisethematik aber lasse ich nun meinen perfekt gepackten Koffer zuhause stehen und finde mich auf dem Podium wieder – völlig ohne Koffer! Es sei Sinnbild für die Befreiung von der zuvor penibel und liebevoll erfolgten Kontrolle und für die Ausrichtung hin zu radikaler Offenheit, Spontanität und emotionaler Durchlässigkeit. Wer immer es erlebt hat, was es bedeutet, ausgerechnet in der Öffentlichkeit seinen inneren „Hochsicherheitstrakt“ aufzugeben, weiß ein Lied zu singen von der unendlichen Weite und Freiheit, die zu schenken man dadurch imstande ist.  Interessanterweise reduzieren sich dann sogar Erlebnisse
Interessanterweise reduzieren sich dann sogar Erlebnisse
partieller Unzulänglichkeiten auf sich selbst und bohren keine generellen
Löcher mehr ins einst ausgemergelte oder wie auch immer verschlüsselte
Selbstbewußtsein. Dem vielbeschworenen Druck auf dem Podium kann auf diese Weise seine beschädigende und einengende Wirkung genommen werden, mehr noch: er kann zum Triebmittel einer kaum geahnten Gesamtleistung mutieren, in welcher wir als Ausführende unser Zentrum behalten oder gar erst richtig erkunden und finden. „Ich habe eigentlich besser gespielt als in jeder Probe zuvor – komisch, denn dieses Mal habe ich doch gar nicht so wahnsinnig viel zuvor investiert an Üben wie sonst….“
Das sind dann die schönsten und regelmäßig geäusserten Sätze, die sich mir einprägen und natürlich nicht nur mich glücklich machen! Wer so spricht, ist sich über sich selbst ein wenig mehr bewußt als vielleicht früher und kann mit diesem neu gewonnenen Ansatz entsprechend entspannt  weiterarbeiten. Ich möchte zu guter Letzt aber nicht versäumen, zu sagen, was mir sehr wichtig ist, wenn man gemeinsam enorme Schritte und Verwandlungen erlebt und durchlebt hat: Es ist eine Art tiefster Dankbarkeit, die sich einstellt und einhergeht mit Zu-Friedenheit. Dankbar für Energien, aus denen Frieden genährt wird.
weiterarbeiten. Ich möchte zu guter Letzt aber nicht versäumen, zu sagen, was mir sehr wichtig ist, wenn man gemeinsam enorme Schritte und Verwandlungen erlebt und durchlebt hat: Es ist eine Art tiefster Dankbarkeit, die sich einstellt und einhergeht mit Zu-Friedenheit. Dankbar für Energien, aus denen Frieden genährt wird.
Pädagogische Fussnote:
„Wenn einer nur darf wenn er soll, aber nie kann, wenn er will,
dann mag er auch nicht, wenn er muß.
Wenn er aber darf wenn er will, dann mag er auch, wenn er soll und dann kann er auch wenn er muß.
Diejenigen die können sollen, müssen wollen dürfen.“
(Quelle unbekannt)